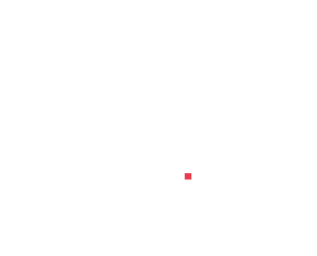Durch eine steuerliche Forschungsförderung will die Bundesregierung erreichen, dass insbesondere die kleinen und mittelgroßen Unternehmen vermehrt in Forschung und Entwicklungstätigkeiten investieren. Erreicht werden soll dieses Ziel durch eine zielgerichtete Ausgestaltung der Förderung, ohne dass die größeren Unternehmen von der Förderung gänzlich ausgeschlossen werden.
Grundsätzlich lässt sich das begünstigte Forschungs- und Entwicklungsvorhaben durch folgende fünf Kriterien bestimmen. Das Forschungs- und Entwicklungsvorhaben muss
- auf die Gewinnung neuer Erkenntnisse abzielen (neuartig),
- auf originären, nicht offensichtlichen Konzepten und Hypothesen beruhen (schöpferisch),
- in Bezug auf das Endergebnis ungewiss sein (ungewiss),
- einem Plan folgen und budgetiert sein (systematisch),
- zu Ergebnissen führen, die reproduziert werden können (übertragbar und/oder reproduzierbar).
Förderfähige Aufwendungen: Um den Arbeitsaufwand für Antragsteller und Finanzverwaltung möglichst gering zu halten, wird die Förderung auf eindeutig und leicht feststellbare wesentliche Aufwendungen des Arbeitgebers begrenzt. Dazu gehört der Arbeitslohn der eigenen Arbeitnehmer. Voraussetzung ist, dass der Anspruchsberechtigte diese Aufwendungen tatsächlich gezahlt hat. Der förderfähige Arbeitslohn ist dabei in der Höhe anzusetzen, für die der Anspruchsberechtigte den Lohnsteuerabzug vorzunehmen hat.
Förderfähige Aufwendungen sind auch Eigenleistungen eines Einzelunternehmers in einem begünstigten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben. Je nachgewiesener Arbeitsstunde, die der Einzelunternehmer mit Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten beschäftigt ist, sind nunmehr 100 € (vorher 70 €) je Arbeitsstunde bei insgesamt maximal 40 Arbeitsstunden pro Woche als förderfähige Aufwendungen anzusetzen. Haben Gesellschafter einer anspruchsberechtigten Mitunternehmerschaft vertraglich vereinbart, dass ein oder mehrere Gesellschafter für Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten in begünstigten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben eine Tätigkeitsvergütung erhalten, dann ist diese Tätigkeitsvergütung förderfähiger Aufwand, soweit sie 100 € je Arbeitsstunde bei maximal 40 Arbeitsstunden pro Woche nicht übersteigt. Voraussetzung ist, dass die Vereinbarung zivilrechtlich wirksam, ernsthaft gewollt und tatsächlich durchgeführt und so eindeutig und klar abgefasst ist, dass sie von anderen Tätigkeitsvergütungen im Dienste der Gesellschaft abgegrenzt werden kann.
Höhe der Forschungszulage: Die Forschungszulage beträgt 25% der Bemessungsgrundlage. Bei einer maximal zulässigen Bemessungsgrundlage in Höhe von 12.000.000 € kann die festzusetzende Forschungszulage damit höchstens 3.000.000 € für einen Anspruchsberechtigten je Wirtschaftsjahr betragen. Der Anspruch auf die Förderung entsteht mit Ablauf des Wirtschaftsjahres, in dem die förderfähigen Aufwendungen entstanden sind bzw. der förderfähige Arbeitslohn vom Arbeitnehmer bezogen wurde. Damit wird klar bestimmt, dass die Forschungszulage wirtschaftsjahrbezogen gewährt wird. Eine Übertragung vom förderfähigen Aufwand auf andere Wirtschaftsjahre ist nicht möglich.
Die Bemessungsgrundlage beträgt höchstens für
- nach dem 1. Januar 2020 und vor dem 1. Juli 2020 entstandene förderfähige Aufwendungen 2.000.000 €,
- nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 28. März 2024 entstandene förderfähige Aufwendungen 4.000.000 €,
- nach dem 27. März 2024 und vor dem 1. Januar 2026 entstandene förderfähige Aufwendungen 10.000.000 € und
- nach dem 31. Dezember 2025 entstandene förderfähige Aufwendungen 12.000.000 €.
Antrag auf Forschungszulage: Die Forschungszulage wird nur auf Antrag des Anspruchsberechtigten gewährt.