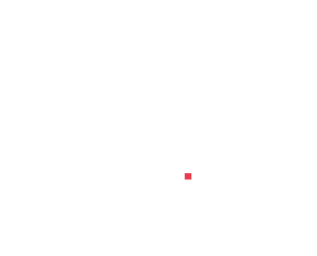Das Bestreben eines Unternehmers "Steuern zu sparen" macht eine rechtliche Gestaltung nicht unangemessen, solange die gewählte Gestaltung zumindest auch von außersteuerlichen Gründen bestimmt gewesen ist. Gründen daher Ehegatten jeweils ein Unternehmen an derselben Anschrift, ist darin noch keine künstliche Aufspaltung und damit kein Missbrauch zu sehen.
Praxis-Beispiel:
Die Klägerin und ihr Ehemann arbeiteten beide im Rahmen eines Mini-Jobs wöchentlich 7 Stunden bei einer Kirchengemeinde (Reinigungskraft, Friedhofsgärtnerin, Pflege der Außenanlagen). Die Klägerin als auch ihr Ehemann meldeten jeweils getrennt ein Einzelunternehmen "Grabpflege und Grabgestaltung" an. Der Umsatz der beiden Einzelunternehmen lag jeweils unter 17.500 €. Die von beiden Eheleuten beantragte Kleinunternehmerregelung lehnte das Finanzamt ab, weil keine getrennten Geschäftsräume vorlagen und die Eheleute einen gemeinsamen Kundenkreis hatten. Daher ging das Finanzamt davon aus, dass die Anmeldung des zweiten Gewerbebetriebs ausschließlich das Ziel hatte, die Umsatzgrenzen für die Anwendung der Kleinunternehmerregelung nicht zu überschreiten.
Das Finanzgericht hat entschieden, dass die Klägerin die Kleinunternehmerregelung nicht missbräuchlich in Anspruch genommen hat. Ob zwei Einzelunternehmen oder ein Zusammenschluss natürlicher Personen als Unternehmer vorliegt, hängt davon ab, wen die Leistungsempfänger als Schuldner der vereinbarten Leistung anhand der abgeschlossenen zivilrechtlichen Vereinbarungen ansehen. Eheleute sind jedenfalls nicht verpflichtet, jeweils selbständige Tätigkeiten zu einem Unternehmen zu bündeln und einheitlich anzubieten. Sie dürfen auch getrennte Unternehmen führen. Die Forderung, wonach Eheleute Leistungen "aus einer Hand" anbieten müssten, würde Eheleute allein aufgrund ihrer Ehe benachteiligen. Dies würde gegen das Grundgesetz verstoßen.
Beide Ehegatten sind jeweils für ihre Kunden erkennbar eigenständig nach außen aufgetreten. Sie haben jeweils ein eigenes Gewerbe angemeldet und unter eigenem Namen und in eigener Verantwortung Leistungen gegenüber den Kunden erbracht. Auch haben sie mit jeweils eigener Steuernummer, eigenem Briefkopf und mit eigenen Rechnungs- und Kundennummern abgerechnet. Unerheblich ist die Angabe derselben Anschrift und Telefonnummer auf den Rechnungen und die gemeinsame Nutzung des Arbeitszimmers. Ohne Bedeutung ist auch, dass sich die Leistungsangebote der Klägerin und die ihres Ehemanns ergänzen und teilweise überschneiden und dass sie teilweise auch identische Kunden hatten. Denn hierbei handelt es sich um marktübliche Vorgänge, die im täglichen Wirtschaftsleben ständig vorkommen.
Hinweis: Eine zweckwidrige Inanspruchnahme der Kleinunternehmerregelung liegt nur dann vor, wenn Umsätze planmäßig aufgespalten und künstlich zwischen Unternehmen mit dem Ziel verlagert werden, die Kleinunternehmergrenze jeweils nicht zu überschreiten. Dies ist nach Auffassung des Finanzgerichts hier nicht zu erkennen. Vielmehr hat die Klägerin nachvollziehbar außersteuerliche Gründe für die gewählte Gestaltung dargelegt. So wollte die Klägerin aufgrund der Behinderungen ihrer Kinder mit flexibleren Arbeitszeiten zum Familieneinkommen hinzuverdienen. Da sie körperlich Grabsteine nicht bewegen konnte, konzentrierte sie ihre Tätigkeit auf die Grabpflege.
Steueroptimierung ist zulässig! Die von den Ehegatten gewählte Aufteilung der verschiedenen Tätigkeitsbereiche entspricht nach Auffassung des Finanzgerichts einer zulässigen Steueroptimierung. Eheleute sind nicht verpflichtet, jeweils selbständige Tätigkeiten in einem Unternehmen zu bündeln. Sie dürfen auch getrennte Unternehmen führen, die dann ggf. aufgrund der Höhe ihrer erzielten Umsätze in den Anwendungsbereich der Kleinunternehmerregelung fallen.
Gesetzesänderungen: Die Umsatzgrenze des Vorjahres in § 19 Abs. 1 UStG in Höhe von 17.500 € wurde ab 2020 auf 22.000 € und ab 2025 auf 25.000 € erhöht.