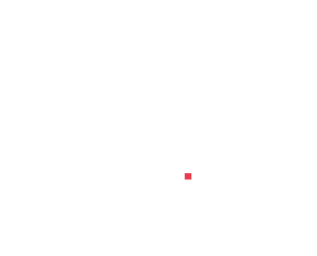Das Finanzgericht Düsseldorf hat entschieden, dass ein Arbeitnehmer, der als Leiharbeitnehmer temporär bei einem Kunden tätig wird, dort keine „erste Tätigkeitsstätte“ im Sinne des § 9 Abs. 4 EStG hat.
Praxis-Beispiel:
Der Kläger war seit dem 16.8.2021 als Mitarbeiter einer Firma tätig. Vertraglich war bestimmt, dass er in der Niederlassung der Firma eingestellt wird. Der Sitz dieser Niederlassung gilt als erste Tätigkeitsstätte, sodass ein Fahrtkostenersatz nur in Betracht kommt, wenn die Aufwendungen für die Fahrt zwischen Wohnort und Niederlassung darüber hinausgehen. Es war vereinbart, dass die Firma als Personaldienstleistungsunternehmen seine Mitarbeiter an wechselnden Einsatzstellen bei Kundenbetrieben einsetzt. Der Mitarbeiter erklärte sich damit einverstanden.
Der Arbeitsvertrag wurde „unbefristet abgeschlossen“. Einsatzort des Klägers als Testkoordinator wurde ab 16.8.2021 ein Betrieb in Bayern, wobei die geplante Dauer des Einsatzes mit „Ende offen“ bestimmt war. Mit weiterer Einsatzeinweisung vom 2.5.2022 wurde die unmittelbare Fortsetzung des Einsatzes in dem Betrieb in Bayern, wieder mit „Ende offen“ bestimmt. Nach einer Bescheinigung des Arbeitgebers vom 11.9.2023 stand der Kläger bis zum 3.2.2023 bei dem Kunden in Bayern im Einsatz. Vom 4.2.2023 bis 29.5.2023 war er projektlos und seit dem 30.5.2023 wieder bei demselben Kunden in Bayern eingesetzt.
Mit Bescheid vom 7.7.2023 zur Einkommensteuer 2022 berücksichtigte das Finanzamt als Fahrtkosten des Klägers die Entfernungspauschale von 0,30 € an 194 Tagen für 7 km, d.h. der Entfernung zwischen der Zweitwohnung des Klägers und dem Sitz des Entleihers in Bayern. Zusätzlich erkannte es die erklärten Mehraufwendungen für eine doppelte Haushaltsführung an.
Das Finanzgericht entschied, dass eine Abrechnung nach Reisekostengrundsätzen vorzunehmen ist. Gemäß § 1 Abs. 1b Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) muss der Arbeitsvertrag und die maximale Überlassungsdauer eine zeitliche Begrenzung für die Zuordnung zu einer bestimmten Tätigkeitsstätte vorsehen. Dadurch greift die Standardregelung für den Abzug von Fahrtkosten über die „Entfernungspauschale“ nicht, sodass der Arbeitnehmer seine Reisekosten nach den vorteilhafteren „Reisekostengrundsätzen“ absetzen kann. Somit ist die Pauschale von 0,30 € nicht nur für die Entfernungskilometer, sondern für die gefahrenen Kilometer abzugsfähig.
Das Finanzgericht führt aus, dass die Regelung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG), die eine maximale Überlassungsdauer vorschreibt, auch für die steuerliche Beurteilung relevant sein muss. Die frühere abweichende Auffassung der Finanzverwaltung ist nicht mehr relevant. Hintergrund hierfür ist, dass sich ein Arbeitnehmer aufgrund dieser gesetzlichen Begrenzung nicht dauerhaft oder langfristig auf eine bestimmte Tätigkeitsstätte einstellen kann und somit auch seine Fahrtkosten nicht entsprechend vermindern oder optimieren kann. Zudem wird in dem Urteil auf den Unterschied zwischen der 18-monatigen Begrenzung im AÜG und dem Zeitraum von 48 Monaten, wie er in der steuerlichen Regelung für eine dauerhafte Zuordnung herangezogen wird, hingewiesen.
Fazit: Das Finanzgericht sieht eine Wechselwirkung zwischen arbeitsrechtlichen und steuerrechtlichen Regelungen. Es wirft jedoch auch wesentliche Fragen zur Abstimmung dieser Vorschriften auf, was die Zulassung einer möglichen Revision durch den Bundesfinanzhof rechtfertigt. Es ist ein relevanter Beschluss für Arbeitnehmer in ähnlichen Überlassungssituationen.