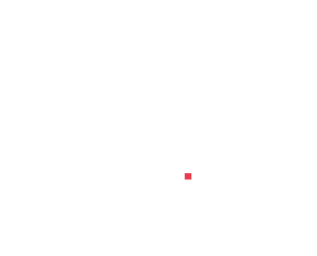Ein Minijob kann vom Arbeitgeber oder vom Minijobber beendet werden. Grundsätzlich gelten für Minijobs dieselben Kündigungsfristen wie bei anderen Beschäftigungen. Wer das Arbeitsverhältnis kündigen möchte, muss grundsätzlich eine gesetzliche Frist von vier Wochen (28 Tage) zum 15. oder zum Ende eines Kalendermonats einhalten.
Praxis-Beispiel:
Eine Studentin arbeitet als Verkäuferin in einem Café. Sie möchte zum Ende des Monats Juni kündigen. Damit die Kündigung wirksam wird, muss sie ihr Schreiben spätestens am 2. Juni abgeben, da nur so die Frist von 28 Tagen eingehalten wird.
Je nach Dauer der Beschäftigung gelten längere Kündigungsfristen. Je länger ein Minijobber im Betrieb arbeitet, desto mehr Zeit müssen Arbeitgeber für eine Kündigung einplanen. Wichtig: Die verlängerten Fristen gelten ausschließlich für Kündigungen, die von Arbeitgeberseite ausgesprochen werden. Minijobber können auch nach vielen Jahren mit der regulären Frist von vier Wochen kündigen. In Arbeits- oder Tarifverträgen können vom Gesetz abweichende Kündigungsfristen vereinbart sein. Für die Berechnung der Kündigungsfrist gilt:
- Vier Wochen bedeuten genau 28 Kalendertage.
- Zwischen dem Tag, an dem die Kündigung beim Empfänger ankommt und dem gewünschten Ende des Arbeitsverhältnisses müssen mindestens 28 Tage liegen.
- Der Tag, an dem die Kündigung zugestellt wird, darf bei der Berechnung der Frist nicht berücksichtigt werden.
- Wochenenden und Feiertage werden mitgezählt, da es sich um eine Wochenfrist handelt.
Beispiel für die Fristenberechnung
Die Kündigung eines Minijobs soll zum 31. Juli erfolgen. Ausgehend vom letzten Arbeitstag wird die Frist so berechnet: 31.Juli - 28 Tage = 4. Juli. Da der Tag, an dem die Kündigung zugestellt wird, nicht mit einberechnet wird, muss die Kündigung spätestens am 3. Juli zugestellt sein.
Kündigung während der Probezeit
Wurde zu Arbeitsbeginn eine Probezeit vereinbart, gilt eine verkürzte gesetzliche Kündigungsfrist von zwei Wochen (14 Tagen) für beide Seiten. Diese Regelung gilt für höchstens sechs Monate ab Arbeitsbeginn. In Arbeits- oder Tarifverträgen kann eine kürzere Probezeit vereinbart werden - aber sie darf niemals länger als sechs Monate dauern.
Kündigung einer befristeten Beschäftigung
Auch bei einer befristeten Beschäftigung - zum Beispiel bei einer Aushilfe - ist es möglich, im Vertrag für die ersten drei Monate eine kürzere Kündigungsfrist festzulegen.
Kann der Minijob auch fristlos gekündigt werden?
In bestimmten Ausnahmefällen ist eine Kündigung auch fristlos - also ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist - möglich. Das gilt sowohl für Minijobber als auch für Arbeitgeber. Voraussetzung ist allerdings ein wichtiger Grund, der es unzumutbar macht, das Arbeitsverhältnis bis zum Ablauf der normalen Kündigungsfrist fortzuführen. Beispiele für solche Gründe sind:
- Diebstahl am Arbeitsplatz
- wiederholte grobe Beleidigungen
- schwerwiegendes Fehlverhalten, das dem Unternehmen schadet
- wiederholt ausbleibende Zahlungen des Verdienstes
Ob eine fristlose Kündigung rechtlich zulässig ist, hängt immer vom Einzelfall ab. Hier empfiehlt es sich, im Zweifel rechtlichen Rat einzuholen.
Eine Kündigung ist nur dann rechtswirksam, wenn sie schriftlich auf Papier erfolgt und eigenhändig unterschrieben ist. Kündigungen per E-Mail, SMS, WhatsApp oder mündlich sind nicht gültig - selbst dann nicht, wenn beide Seiten einverstanden wären. Die sogenannte elektronische Form reicht nicht aus.
Damit im Zweifel nachgewiesen werden kann, wann die Kündigung zugestellt wurde, sollte diese
- persönlich übergeben werden. Der Empfang kann zusätzlich schriftlich bestätigt werden.
- per Einwurfeinschreiben versendet werden, um den Zugang nachweisen zu können.
Allgemeiner Kündigungsschutz
Auch Minijobber können unter das allgemeine Kündigungsschutzgesetz fallen, wenn der Betrieb mehr als 10 Beschäftigte hat und das Arbeitsverhältnis länger als 6 Monate besteht. Sind beide Voraussetzungen erfüllt, muss eine Kündigung außerdem sozial gerechtfertigt sein. Das ist beispielsweise der Fall, wenn die Kündigung
- betriebsbedingt (z. B. Arbeitsplatz fällt weg),
- verhaltensbedingt (z. B. wiederholte Unpünktlichkeit) oder
- personenbedingt (z. B. dauerhafte Erkrankung) erfolgt.
Wichtig: In kleinen Betrieben mit bis zu 10 Beschäftigten besteht kein allgemeiner Kündigungsschutz. Eine Kündigung darf dann auch ohne einen bestimmten Grund erfolgen.
Einige Personengruppen genießen besonderen Schutz vor Kündigungen, unabhängig von der Betriebsgröße oder der Beschäftigungsdauer.
Dazu zählen unter anderem:
- Schwangere (ab dem ersten Tag der Schwangerschaft)
- Eltern in Elternzeit
- Schwerbehinderte
In diesen Fällen ist eine Kündigung nur mit Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde zulässig.